Bei schönerem Wetter hätte mir Ramallah besseren Eindruck gemacht. Was im Zürcher November der graue nieselige Hochnebel ist, sind hier Sandwolken, feiner Staub der sich auch tagelang hält, auf Bäume und Autos legt, man spürt ihn manchmal auf der Zunge und der Dreck hängt wie ein feiner Schleier vor der Sonne. An manchen Tagen sieht man die obersten Geschosse der Hochhäuser am Ende unserer Strasse nicht mehr.
Zwei oder drei Mal im Jahr liegt so viel Staub in der Luft, dass es tagsüber apokalyptisch eindunkelt und die Sonne blutrot anläuft, als kriege sie keine Luft mehr und ersticke gleich. Danach regnet es erstmal dreckiges Wasser.
Meine Freundin aus dem diplomatischen Korps hatte mich am Samstag in einer SMS spontan eingeladen, sie zu einem Lunch am Sonntag in Ramallah zu begleiten.

Angeblich die Flaggen aller Staaten, die Palästina bis dato als Staat anerkannt haben. Manche von Wind und Wetter zerfetzt, manche auf Halbmast. Eine grosse Baubrache neben Arafats ehemaligem Machtzentrum.
Ich hatte ihr ein paar Wochen zuvor gestanden: Mit jedem Monat, den ich länger hier in Israel lebte, wurde die Vorstellung eines Besuchs beim Feind unheimlicher. Warum, weiss ich nicht. Die Medien? Die Gehirnwäsche einer Nation im Kriegszustand? Gruppenzwang eines traumatisierten Volks? Die Raketen aus Gaza im letzten Herbst?
Ich sagte meine Bürotermine für Sonntag ab.
Tel Aviv Richtung Jerusalem, nach 45 Minuten rechts abbiegen
Beim ersten Besuch in Israel, vor zwei Jahren, war ich mit Gabi unterwegs nach Jerusalem, da stand Ramallah angeschrieben auf einem Autobahnschild.
Ich hatte sie gefragt: „DA ist Ramallah?“
Ich hatte im MAGAZIN des TagesAnzeigers gelesen, dass dort viele junge Expats leben, UNO-Mitarbeiter und NGO-Workers, Hilfswerker, Friedensstifter, Abenteurer, und dass sie cool drauf sind und gute Bars und Parties machen zusammen mit den Palis. Es hatte sich aufregend und vielversprechend angehört. Etwas gefährlich vielleicht, aber ohne wirklich gefährlich zu sein. Nicht wie Saigon 1965 oder Beirut 1985. Aber doch irgendwie mit diesem schwitzigen Uniform-Geruch in der Luft, den blauäugigen blonden Fotoreportern, zähen Geschäftemachern und Abenteuern.
Sie sagte: „Ja klar, da ist Ramallah.“
Ich wollte sie fragen, ob wir da hinfahren können, aber ich hatte eine Ahnung.
Darum fragte ich vorsichtiger: „Warst du schonmal da?“
Meine Frau: „Spinnst du? Ich will nicht vergewaltigt werden.“
Araber stinken. Man lernt das so hier.
Die Diplomatin und ich im Botschafterwagen, wir fuhren am Sonntag um 10:30 in Tel Aviv los. Wir waren um 12 Uhr mit dem japanischen Diplomaten in Ramallah verabredet. Er würde uns vor einem der bekannten Expat-Hotels treffen und dann in ein gutes Restaurant mitnehmen.
Eine gute Dreiviertelstunde Ostwärts auf der Siedler-Autobahn, Schnellstrasse 443, lag vor uns. Die Siedler-Autobahn ist eine von zwei Autostrecken zwischen Tel Aviv und Jerusalem.
Die 1 ist die Haupt-Achse, sie wird derzeit durchgängig auf 6 Spuren erweitert. Die 443 führt durch die Westbank und bedient unterwegs Settlements. Palästinensern ist der Zugang zur Strasse gesperrt. Sie ist links und rechts eingezäunt. Siedler-Autobahn.
Ramallah ist Teil der Zone A, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird. Aus Sicherheitsgründen ist Juden der Zugang zur Zone A verboten. Egal mit welchem Pass. Ich bin weder Israeli noch Jude. Ich sehe auch nicht aus wie ein Israeli (Juden sehen ja so und so aus, aber Israeli erkennt man).
Darum hatte die Diplomatin auch kein Problem, mich in die Zone mitzunehmen.
Meine grösste Sorge: dass ich bei der nächsten Ausreise und Einreise am Flughafen drangenommen werde. Oder unangenehmer: dass sie mir plötzlich Probleme machen beim Erneuern meiner provisorischen Niederlassungsbewilligung, wenn sie erfahren, dass ich in Ramallah mittagesse.
Ich suchte mir meine Klamotten an dem Morgen sorgfältig aus, um für den Palästinenser zwar möglichst Schweizerisch auszuschauen, aber nicht verwöhnt wohlhabend.
Unterwegs im Auto nach Ramallah fühlte ich mich zum ersten Mal seit langem wieder als Schweizer: Neutral. Als Tourist. Als Gast und ohne Verantwortung. Hände ausgestreckt und Handflächen nach oben gedreht. Mal kucken gehen.
Wenn ich in der Schweiz bin, bin ich Besucher aus Israel. Wenn Freunde uns in Tel Aviv besuchen, bin ich der Tel Avivi.
Wenn ich mit meiner Frau reise, behaupten wir in Istanbul, Jordanien oder Kenia zwar beide, dass wir Schweizer sind – mit dem Resultat dass ich mich mit dieser halben Lüge als Israeli fühle. Potenziell von Entführung und Bombenanschlägen bedroht, von keinem gemocht, von allen kritisch beobachtet.
Besser, wenn mir heute kein Wort Hebräisch rausrutscht. Besser, wenn niemand weiss, dass ich in Israel lebe. Besser wenn keiner weiss, dass ich Samuel heisse und eine jüdische Frau habe.
Mal wieder richtig Schweizer sein
Einfach mal gucken gehen, wie die’s in Ramallah haben.
Es tut mir ja leid mit dem was hier alles geht, politisch. Aber ich kann da wirklich nichts dafür. Es ist einfach eine komplizierte Situation. Könnt ihr nicht einfach miteinander reden?
Wir verlassen die Autobahn bei einem der Settlements – mein erstes Settlement. Das Dorf sieht aus wie andere israelische, aus dem Boden gestampfte Kleinstädte. Vielleicht noch etwas trotzigere Architektur. Noch schneller gebaut. Noch weniger Charme.
Richtungsschilder an der Strasse gibt’s hier kaum. Meine Freundin kennt den Weg. Wir biegen mitten im Dorf in eine Seitenstrasse ein, 150m die Strasse runter steht ein trotziger Turm, darum herum viel Gitter, Betonblöcke, Strassenschwellen und Stacheldraht. Checkpoint.
Wir fahren im Schrittempo auf das grosse Maschendrahttor zu, der israelische Soldat verlässt nicht mal sein Kabäuschen, das Tor schwingt lautlos auf und wir fahren durch. Das war’s.
Unser Auto hat CD Nummernschilder. Corps Diplomatique. Diplomatisches Korps. Meine Freundin erklärt, dieser Checkpoint ist nur offen für Diplomaten, UN Mitarbeiter und Sondergenehmigungen.
In die andere Richtung, auf der anderen Strassenseite sehe ich die Schleusen für die Fussgänger, die Palästinenser, die durch den Checkpoint nach Israel wollen. Auf der palästinensischen Seite des Checkpoint stehen geparkte Autos, die Strasse ist bis auf eine Spur in der Mitte zugeparkt mit PWs von Tagesaufenthaltern in Israel.
Wir sind in Zone A. Aber noch nicht in Ramallah.
Die Strasse hier ist schlechter. Es ist ein löchriges Asphaltband auf den Sand gelegt. Links und rechts stehen weissgraue rohe Betonbauten. Hier baut keiner fürs Auge. Es ist unklar, welche Häuser noch im Bau sind, welche schon fertig, bewohnt wirkt hier gar nichts, plötzlich kommt mir auch die Landschaft so anders vor, so trocken, so karg, so unbelebt, steinig, sandig, das diffuse milchige Licht tut das seine dazu, es kommt mir vor als hätte ich meinen Kopf in eine andere Welt gesteckt, in der das Licht diffus, die Frischluft knapp und das Land trocken ist.
Sogar die Karten auf dem Handy sind blank.
Auf Google Maps ist Ramallah als grauer Fleck markiert, ohne Strassennamen. Das Mövenpick Hotel Ramallah wird angezeigt. Das ist alles.
Meine Freundin kennt den Weg. Wir unterqueren die Siedler-Autobahn, deren Sichtschutz-Zäune die Landschaft zerschneiden. Hinter dem Band aus beigen Blachen könnten auch die Schienen eines riesenlangen Rollercoasters liegen, der hier über die Hügel vor Jerusalem flitzt. Irgendwo ist der Einstieg, da muss man anstehen, Karten kaufen und dann Schlange stehen für die nächste Abfahrt.
Dann erreichen wir auch schon die ersten Häuser Ramallahs. Wie’s aussieht wird auch hier wie überall in Israel viel gebaut. Pardon: Wie überall in Israel wird auch hier viel gebaut. Die Architekten scheinen noch etwas weniger gut ausgebildet. Die Ambitionen der Bauherren sind aber hoch. Es stehen einige Paläste an der Strasse, Mischung aus moderner Architektur, Festungsbau und Neureichen-Punk-Prunk.
Wir suchen unseren Treffpunkt
So euphorisch Lonely Planet Ramallah als Happening Place feiert, so dürftig ist auch da die Karte. Sie zeigt 800×800 Meter Innenstadt.
Das wäre eine Aktion: Ramallah auf Google Maps erfassen.
Wir verfahren uns, werden aber von netten Fussgängern zum Treffpunkt gewiesen. Dann folgen wir dem Japaner zum Restaurant.
Wir essen in einem von Christen betriebenen Restaurant. Es wird Tel Aviver Standard geboten, etwas bemühter, man spürt, das ist nicht normal hier. Das tut man für ‘die andern’. Der junge coole Inhaber oder Maitre d’ bedient uns zuvorkommend. Auch die Preise sind hoch. Wir trinken einen Orvieto.
Die Diplomaten tauschen Ansichten und Einsichten aus.
Der Japaner geht Bergsteigen in der Westbank.
Er kennt einige gute Wände in der Gegend.
Nach dem Orvieto fahren wir zu Arafat
Anschliessend besuchen wir die Mukatah, das Hauptquartier der PLO zu Yassir Arafats Zeiten und sein ‘Gefängnis’ von 2002 bis 2004, als israelische Truppen seine Regierungsanlage belagert hielten – und zum grössten Teil zerstörten.
Es ist die einzige touristische Destination Ramallahs.
Das Grab Arafats steht Besuchern offen, es wird von einer Handvoll Soldaten in Paradeuniform bewacht.
Es wird nicht als seine letzte Ruhestätte angesehen. Die soll in Jerusalem sein, wenn der Felsendom wieder zu Palästina und nicht mehr zu Israel gehört.
Nach der etwas surrealen, gespenstisch kahlen und fahlen Kulisse der Mukatah fahren wir ins nahegelege Stadtzentrum, spazieren durch die belebte Hauptstrasse, vorbei am Stars-and-Bucks zum schmutzigen und einfachen, aber gut besuchten Markt mit viel Frischwaren. Wir sind beinahe die einzigen Westler, ich sehe noch eine Asiatin mit einem palästinensischen Begleiter auf dem Markt und einen älteren Abenteurer oder Künstler, der vielleicht 1985 in Beirut war.
Die Türme frisches Gemüse und Früchte auf dem Markt sind wie ein Schock: Das maximal intensive Rot, Grün, Gelb der Peperonis. Das Orange der Khakis und Mandarinen. Die dicken Büschel Bananengelb. Grüner Lattich.
Wo sind die Gewürze? Gewürze machen sich gut als Mitbringsel.
Es ist alles spottbillig.
Während unser Restaurant durchaus Tel Aviver Preise verlangte, ist hier auf dem Markt alles ein Vielfaches billiger.
Gegen fünf stehen wir im massiven Stau im Berufsverkehr vor Tel Aviv. Die Autos in langen Kolonnen vor der Kulisse Tel Avivs, eine gute halbe Stunde weg vom ärmlichen Ramallah, sind Beleg für den Kontrast zwischen den beiden Welten.
Wie sag’ ich’s den andern?
Am nächsten Tag auf Arbeit weiss ich nicht, ob ich die Geschichte erzählen kann.
Bis jetzt bin ich der naive Europäer, der gut meint – aber natürlich nichts versteht. Ich will nicht als Pali-Sympathisant angeschrieben werden.
Mein Foto am Schrein von Arafats Grab, grinsend zwischen den beiden Ehrenwachen, zeige ich keinem.
Als ich Kollege Y dann doch von meinem Ramallah Besuch erzähle, macht er ein sehr eigenartiges Gesicht. Etwas fasziniert, etwas ungläubig, leicht abgestossen, er macht einen Schritt zurück.
Ich hab’s noch einigen anderen Freunden erzählt. Sie stellen fast keine Fragen.
Y schaute, als hätte ich einen Brief von seinem Cousin mitgebracht, der wegen Vergewaltigung im Gefängnis sitzt. Niemand will diesen Brief aufmachen. Was kann da schon drinstehen was man lesen möchte?
Mit diesem Cousin, der eine Frau vergewaltigte (angeblich), hat man seit Jahren keinen Kontakt mehr. Und mittlerweile ist es einfacher so.
Sie fragen schon alle: Wie war’s?
Ich sage: Deprimierend.
Sie sagen: Ja natürlich.
Ich hatte mich in Afrika, in den Städten Kenias, so gefühlt. Vielleicht ist es das Lebensgefühl in Gesellschaften, in der es kein Vertrauen in die Gesellschaft gibt. Die Luft ist knapp für alle.
Dass diese Stadt als Hauptstadt und Teil eines ‘gleichberechtigten’ Staates neben Israels funktionieren könnte, scheint sehr weit hergeholt. Der Vorsprung Israels in jeder Hinsicht ist derart gigantisch, dass von einer Gleichberechtigung, wie sie die Zweistaatenlösung suggeriert, keine Rede sein kann.
Es fühlte sich eher an wie der Besuch in einem Reservat.
Der Besuch beim armen, verkrüppelten Nachbarn.
Ich weiss, ich habe nichts gesehen. Ich war gerade mal zwei, drei Stunden dort.
Ich weiss noch nicht, wann ich wieder hinfahre.
Es scheint so weit weg.
Und was soll ich dort …?
Es gibt dort nichts, was ich brauche.
Was habe ich damit zu tun?

Der Schrein Yasser Arafats, in der Anlage der Mukatah, dem ehemaligen Hauptsitz der PLO, der von israelischen Truppen 2002-2004 belagert und zerstört wurde.



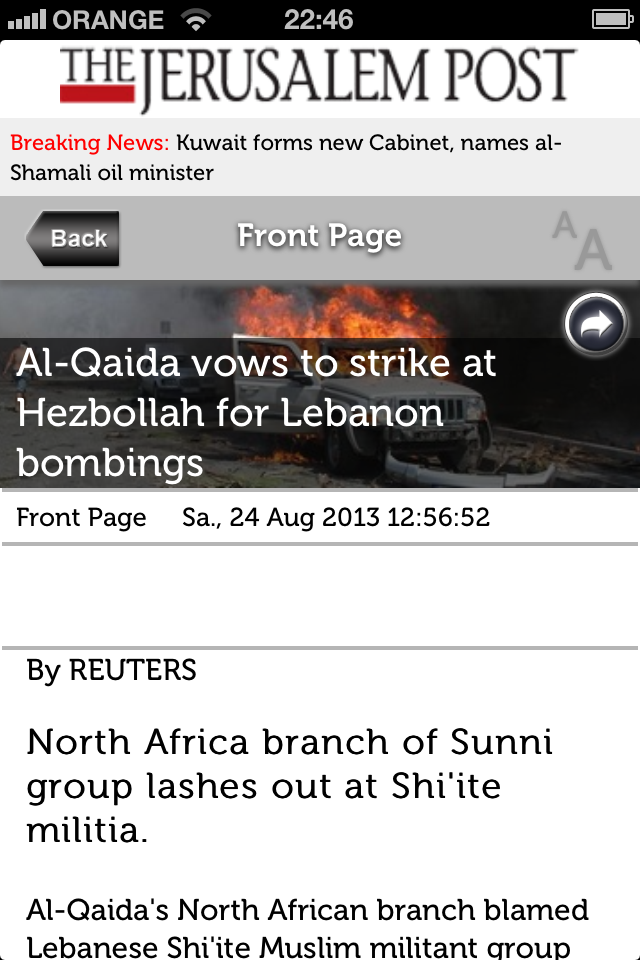



 Wir waschen uns mit sonnenwarmem Wasser aus der Flasche das Salz vom Gesicht. Der Parkplatz ist schon beinahe leer, obwohl die Sonne noch recht hoch am Himmel steht. Viele sind schon auf dem Heimweg. Shabbat endet – und die neue Woche beginnt – mit Sonnenuntergang. Wir sind hungrig auf Hummus, Chips, Salat.
Wir waschen uns mit sonnenwarmem Wasser aus der Flasche das Salz vom Gesicht. Der Parkplatz ist schon beinahe leer, obwohl die Sonne noch recht hoch am Himmel steht. Viele sind schon auf dem Heimweg. Shabbat endet – und die neue Woche beginnt – mit Sonnenuntergang. Wir sind hungrig auf Hummus, Chips, Salat.

